Deskriptive Statistik
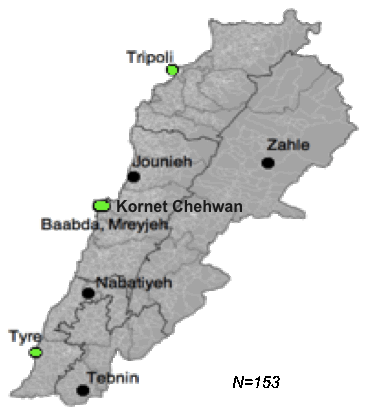
Um den tatsächlichen Bedarf für das Projekt festzustellen, d.h. die aktuelle psychische Situation der Sanitäter zu eruieren, wurde 2010 eine umfassende Studie mit fünf repräsentativen Rot-Kreuz-Stationen, also insgesamt 153 Rettungssanitätern aus den Regionen entlang der Küste des Libanon, durchgeführt.
Die Teilnehmer der Studie waren im Durchschnitt 25 Jahre alt, der jüngste 14, der älteste 48 Jahre alt. 68% der Teilnehmer waren Männer, 31,4% Frauen, ein Teilnehmer machte hierzu keine Angaben.
83% der Teilnehmer waren nach eigenen Angaben im Jahr 2010 unverheiratet, 15% verlobt oder verheiratet, 0,7% geschieden. 18,4% der Sanitäter gaben an, mindestens ein Kind zu haben.
Ausmaß der Stressbelastung
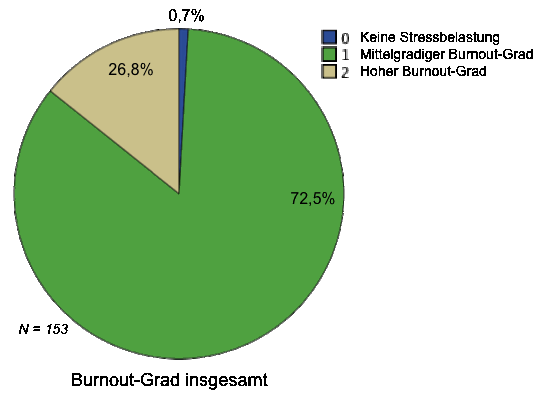
Um die Stressbelastung der Sanitäter zu messen, wurden verschiedene Instrumente herangezogen. Das "Maslach Burnout Inventar" misst ein Phänomen, das als Diagnose unter Fachleuten umstritten ist, jedoch in der Praxis ein Syndrom beschreibt, das sich kulturübergreifend finden lässt. Das sogenannte "Burnout-Syndrom" beschreibt die Symptome einer mittelgradigen bis schweren depressiven Episode, deren Ursache in einer emotionalen und/oder beruflichen Überforderung und chronifizierter Erschöpfung zu suchen sind. Das "Burnout-Syndrom" nach Maslach & Jackson, 1981, definiert sich aus Emotionaler Erschöpfung, Depersonalisierung (d.h. Wahrnehmung der Patienten/Klienten als Objekte) und das Absinken der persönlichen Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich mithilfe des Fragebogens die Ausprägung des Burnout-Grades bestimmen. Wie der nebenstehenden Graphik zu entnehmen ist, beträgt der Anteil ungestresster Sanitäter lediglich 0,7%, während 27% unter einem hohen Burnout-Level leiden. Die meisten der Rot-Kreuz-Helfer (73%) sind nach der Maslach'schen Definition mittelgradig belastet und sind somit als Risiko-Population für Stresserkrankungen einzustufen.
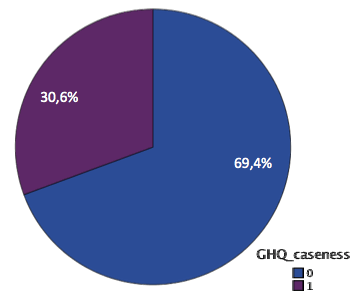
Anhand des "General Health Questionnaires" lässt sich feststellen, bei welchem Anteil der Teilnehmer eine behandlungsbedürftige Stressbelastung vorliegt. Das Ergebnis ist frappierend: Knapp ein Drittel aller Studienteilnehmer haben ein Belastungslevel erreicht, das eigentlich dringend der Therapie bedürfe. Meine Befragung von Experten der Vereinten Nationen sowie der großen Universitäten Beiruts bzgl. der therapeutischen Angebote war desillusionierend. Die Zahl der Therapieplätze steht bereits in der Hauptstadt in keine Verhältnis zum Bedarf, in ländlichen Regionen gibt es noch weniger psychosoziale Einrichtungen. Die Akzeptanz psychischer Probleme ist in Bevölkerung und Regierung noch nicht flächendeckend akzeptiert, weshalb die psychosoziale Infrustruktur des Landes noch nicht annähernd ausreichend ausgebaut ist. Zwar versuchen Organisationen wie UNDP Artgold, das International Medical Corps, Lebanese Welfare Association for the Handicapped, World Vision und ähnliche NGOs, diese Lücken zu füllen, allerdings gelingt dies nur sehr vereinzelt und für sehr spezifische Berufsgruppen.
Prävalenz der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
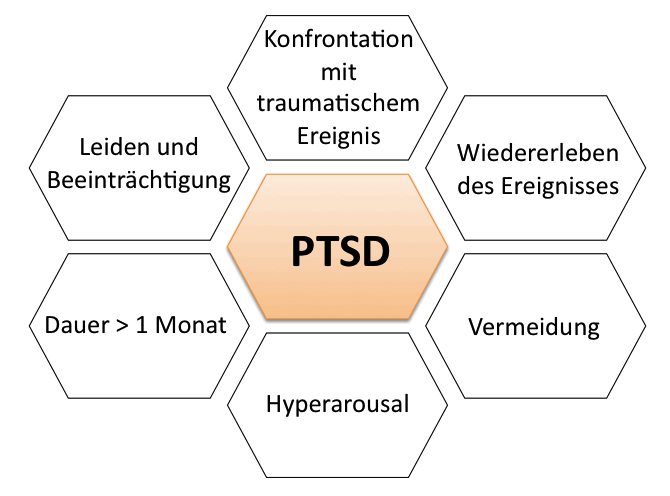
Nach dem Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen (Saß et al., 2007) ist die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wie links abgebildet definiert: Der/Die Betroffene muss einem traumatischen Ereignis ausgesetzt gewesen sein, das existenzielle Furcht, massives Entsetzen und Bedrohung von Leib und Leben der Person selbst oder einer Personen aus dem Umfeld des/der Betroffenen beinhaltete. Infolge dieses Ereignisses erlebt der/die Betroffene sich aufdrängende Erinnerungen in Form von gedanklichen Intrusionen, Flashback-Wahrnehmungen und/oder Albträume (Wiedererleben). Aufgrund des Leidensdrucks stellt sich Vermeidungsverhalten ein, z.B. um eben jenen Erinnerungen oder einer erneuten Konfrontation mit dem traumatischen Erlebnis zu entgehen. Gleichzeitig lässt das durch Stress und Schock des Traumas erfahrene Erregungslevel nicht ausreichend nach, was Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit, Schlafstörungen und Hypervigilanz nach sich zieht. Eine PTBS ist dann erfüllt, wenn diese Symptomatik über eine Zeitspanne von mindestens einem Monat besteht und einen spürbaren Leidensdruck nebst Beeinträchtigung der Alltagsbewältigung mit sich bringt.
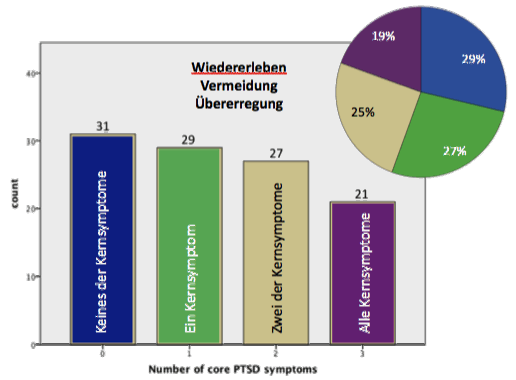
5,9% der Sanitäter erfüllten die streng interpretierten klinischen Diagnose-Kriterien (s.o.), während Karam et al. (2008) in der libanesischen Allgemeinbevölkerung nur 3,4% behandlungsbedürftiger Traumapatienten feststellen konnten.
Der Belastungsgrad der Sanitäter ist jedoch jenseits der strengen Auslegung der Diagnosekriterien weit höher, betrachtet man die Prävalenz der Kernsymptome für PTBS: Wiedererleben, Vermeidungsverhalten und Hypervigilanz. In der nebenstehenden Graphik kann man erkennen, dass lediglich 29% der befragten Sanitäter frei von den Kernsymptomen für PTBS sind, 19% aller Teilnehmer leiden unter allen drei typischen PTBS-Symtpomen, 44% unter mindestens zwei. Daraus kann geschlossen werden, dass die finale Diagnose bei diesen Individuen lediglich an einem Nebenkriterium wie z.B. der Beeinträchtigung der Alltagsbewältigung scheitert. Nicht auszuschließen, dass die Teilnehmer aus kulturellen und subkulturellen Gründen "die Zähne zusammenbeißen" und sich daher keine Schwächen aufgrund ihrer Symptomatik zugestehen.
Regionale Verteilung von Stress und Traumatisierung
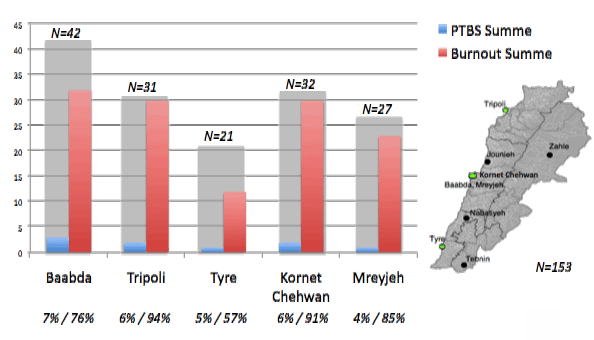
Bei meinen Workshops quer durch den Libanon schilderten mir die Sanitäter immer wieder, dass es Stationen gebe, die aus verschiedenen Gründen schwerer belastet seien als andere. Am häufigsten wurden die Stationen "Tripoli" und "Tyre" genannt. Tripoli liegt, wie man auf der Karte sehen kann, im Norden des Landes nahe der Syrischen Grenze. Die Stadt wird bis zum heutigen Tage von Anschlägen heimgesucht, sei es aufgrund laufender Konflikte zwischen verfeindeten Klans, seien es die Kämpfe um das palästinensischen Flüchtlingslager Nahr el-Bared, sei es das Übergreifen des Syrienkonflikts auf die Grenzregionen des Libanon. Tyre seinerseits befindet sich im Süden des Landes, nahe der Israelischen Grenze. Insbesondere während des Juli-Krieges 2006 war diese Station massiv gefordert, da die Sanitäter unter Einsatz ihres Lebens die Betroffenen in der Region versorgten und einige während dieser Einsätze tatsächlich verwundet oder getötet wurden. Heutzutage ist diese Station weniger hart betroffen und ist überwiegend mit den alltäglichen Stressoren des libanesischen Sanitäterberufs konfrontiert: Verkehrsunfälle, Minenopfer, akute Erkrankungen oder Verletzungen. Die obenstehende Graphik macht deutlich, wie wichtig es ist, die individuelle Situation und Geschichte der jeweiligen Station zu beachten, wenn man die Schwerpunkte eines psychosozialen Hilfsprojekts setzt.
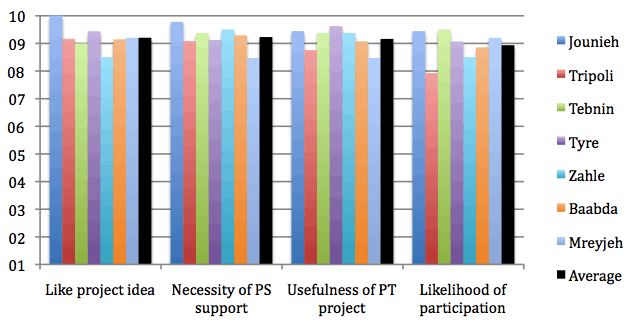
Im Rahmen der Probeworkshops für ausgewälte Rot-Kreuz-Stationen wurde den Sanitätern auch das Konzept für das geplante Projekt vorgestellt und anschließend ihre Meinung dazu schriftlich und anonym eingeholt. Nicht nur die persönlichen Gespräche, sondern auch das Ergebnis dieser Evaluation zeigte, dass auch der subjektiv empfundene Bedarf der Ehrenamtlichen sehr deutlich für die Umsetzung des Projekts spricht. Das ausführliche Feedback und das Ergebnis der Sammlung der gravierendsten Stressoren findet sich hier:
Feedback 2010
Stand: 20.07.2013
Literatur
Bühner, M. (2006). Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion. München: Pearson.
Foa, E.B., Cashman, L., Jaycox, L., & Perry, K. (1997). The validation of a self-report measure of posttraumatic stress disorder: The Posttraumatic Diagnostic Scale. Psychological Assessment, 9, 445-451.
Goldberg, D. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 9(1), 139-145.
Gray, M.J., Litz, B.T., Hsu, J.L., & Lombardo, T.W. (2004). Psychometric Properties of the Life Events Checklist. Assessment, 11(4), 330-341.
Maslach, C. & Jackson, S.E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
Maslach, C., Schaufeli, W., & Leiter, M. (2000). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
Saß, H., Wittchen, H.-U., Zaudig, M. & Houben, I. (2003). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen - Textrevision. Göttingen: Hogrefe. (Amerikanische Originalausgabe: American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition, Text Revision. Washington/DC: Author.).
Wong, P.T.P., Reker, G.T., & Peacock, E.J. (2006). A resource-congruence model of coping and the development of the coping schemas inventory. In: P.T.P. Wong & L.C.J. Wong (Eds.), Handbook of Multicultural Perspectives on Stress and Coping (pp. 223-283). New York, NY: Springer.





